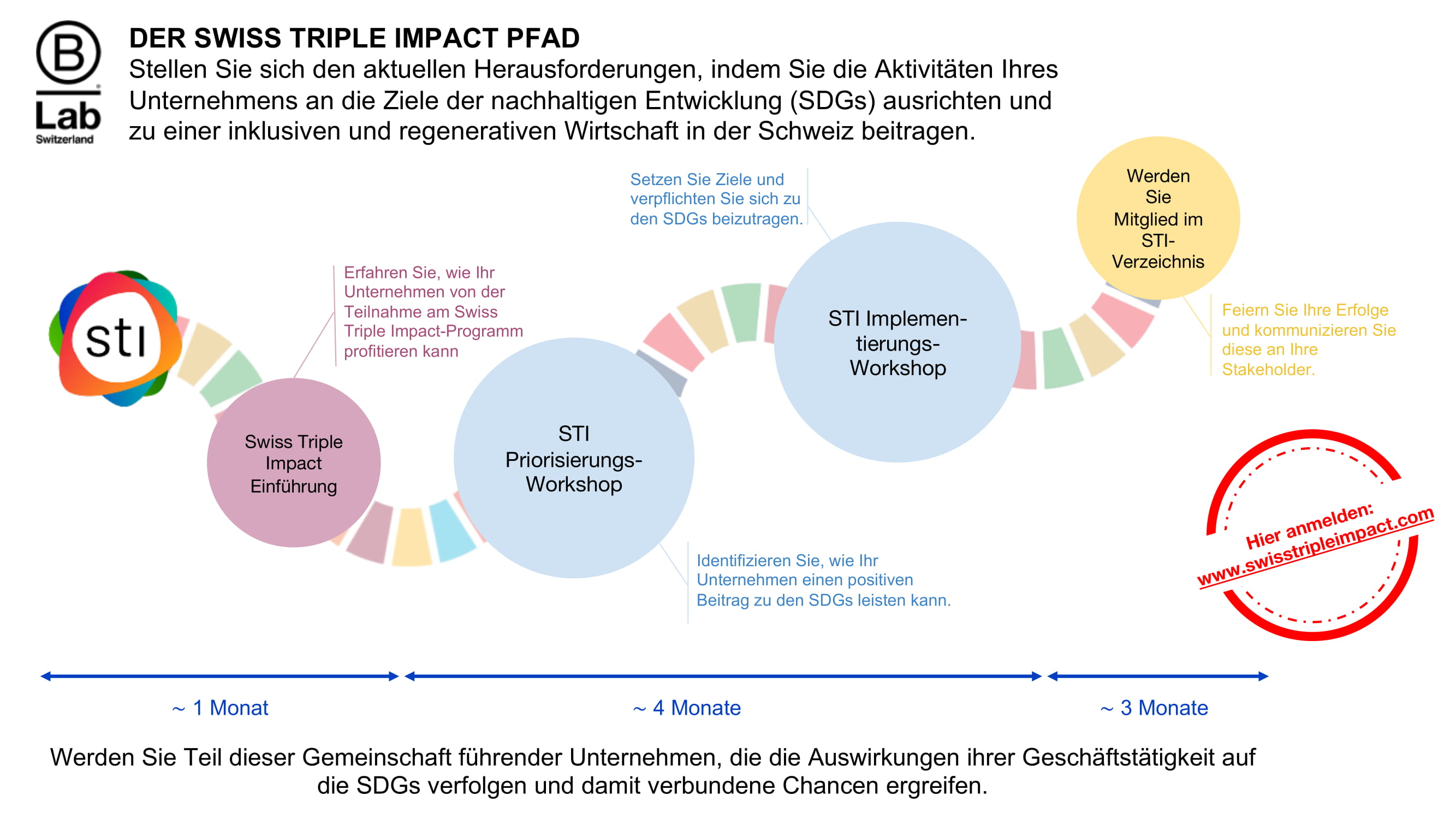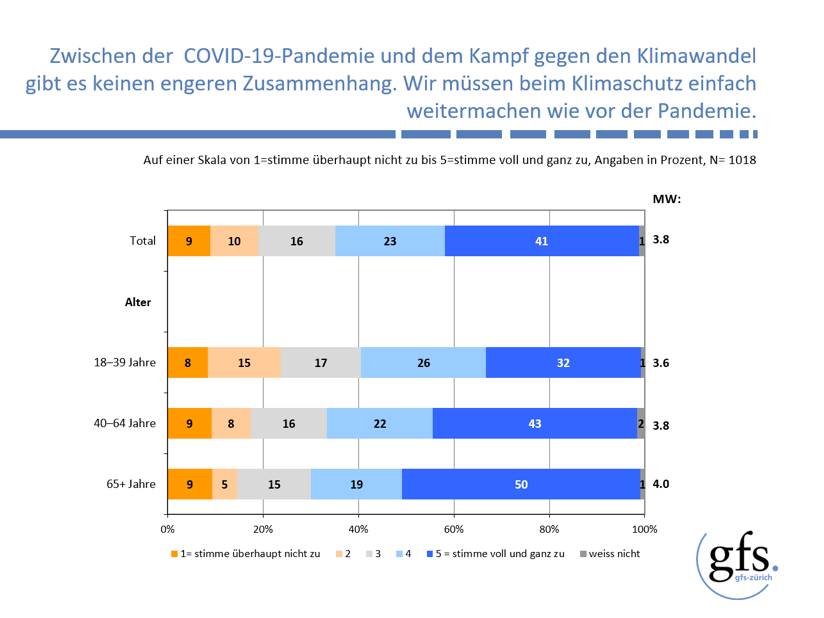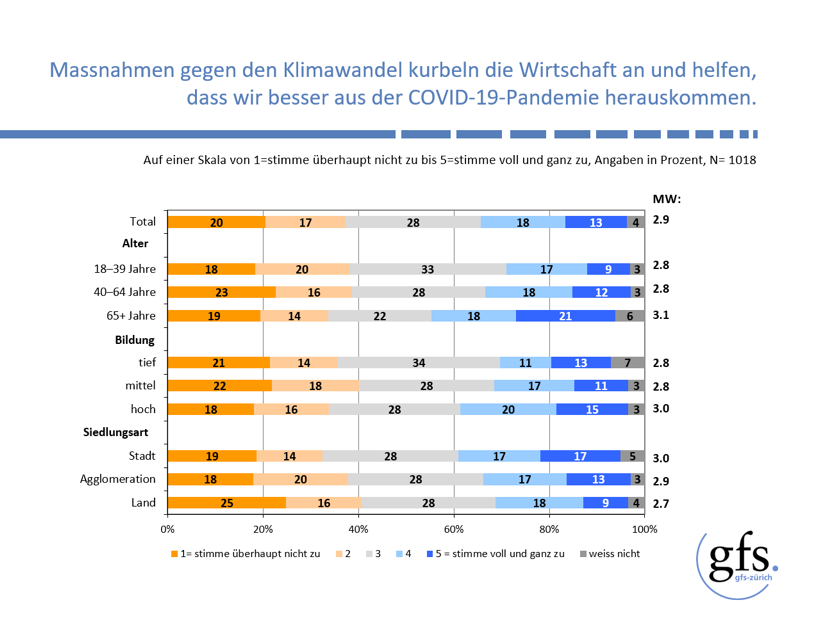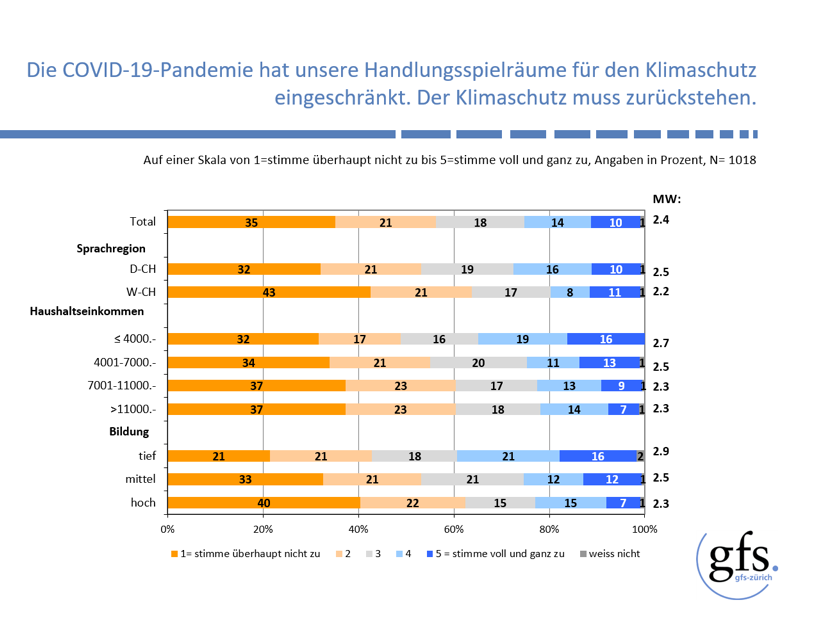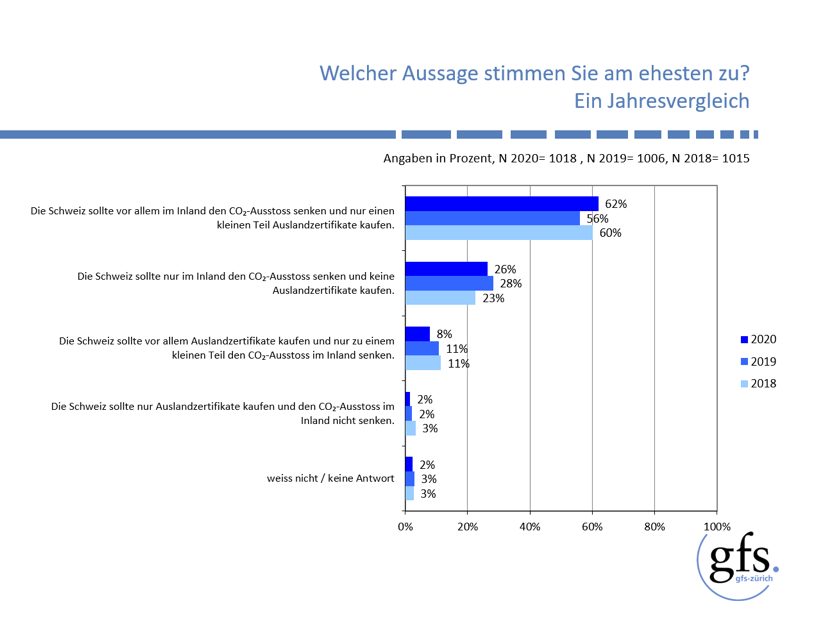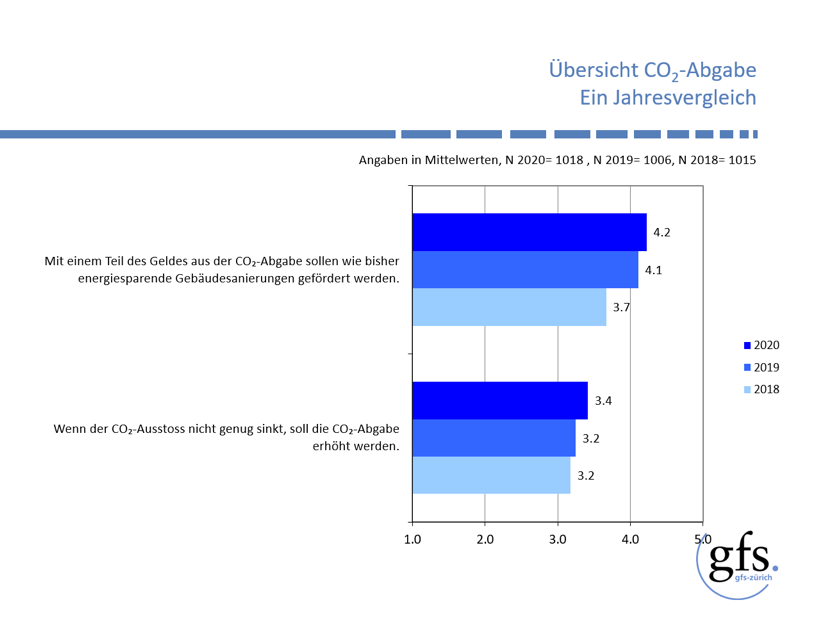Im ersten Referat widmete sich Dominique Kronenberg, COO des mittlerweile auf 130 Mitarbeitenden angewachsenen Start-ups Climeworks, dem Thema der negativen Emissionen. Die von Climeworks entwickelte Technologie absorbiert CO2 aus der Luft und fängt es konzentriert ein. Heute bestehe das Businessmodell vor allem darin, CO2 für Anwendungen, wie zum Beispiel die Begasung von Treibhäusern oder die Herstellung von kohlensäurehaltigem Mineralwasser, zur Verfügung zu stellen. Sobald begonnen wird, CO2 aus der Atmosphäre zu filtern und im Boden zu lagern, wird sich der Anwendungsbereich der Technologie um ein Vielfaches multiplizieren. Dies würde einen grossen Beitrag leisten zum Klimaschutz. Auf die Frage, was der Erfolgsfaktor für ein Start-up sei, antwortete Kronenberg, dass persönliches Stehvermögen und gute Partnerschaften –innerhalb und ausserhalb der Firma – für den Erfolg zwingend seien.
Die bereinigte CO2-Buchhaltung
Im zweiten Referat stellte Lone Feifer, Director Sustainability & Architecture der VELUX Group und General Secretary der Active House Alliance, die Relevanz von Tageslicht und automatischen Fenstern vor. Letztere könnten zu einem Kernelement des intelligenten Hauses werden, welches mit einem Minimum an Energie ein Maximum an Gesundheit und Behaglichkeit für die Bewohner sicherstellt. Schlüsselkomponente dieser Fenster sind sogenannte Aktoren. Diese erlauben es, das Fenster automatisch zu beschatten, um Blendung zu vermeiden, und stellen durch elektrische Kipplüftung auch die Luftqualität sicher. Zudem investiert VELUX Group in eine nachhaltige Produktion und hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2041 CO2-neutral zu werden und sämtliche Emissionen, welche die Firma seit der Gründung ausgestossen hat, wieder aus der Atmosphäre zu holen. Dieses ambitionierte Projekt entstand in Zusammenarbeit mit dem WWF und fokussiert auf Aufforstungen, mit denen CO2 im Holz des Waldes assimiliert werden soll.
Picking the Right
Im dritten Vortrag machte Steve Westly, Serial Entrepreneur und Chef eines grossen amerikanischen Investmentfonds, zwei Dinge deutlich. Erstens ist heute möglich, was vor 10-15 Jahren noch undenkbar war: mit nachhaltigen Produkten und nachhaltigen Firmen lässt sich eine erhebliche Mengen Geld verdienen. Am Beispiel der Kostensenkungskurve im Bereich der Photovoltaik und der Batteriepreise zeigte er auf, dass in den nächsten Jahren kein Weg an nachhaltigen Technologien vorbei führt. Zweitens wies Westly darauf hin, dass ohne die aktive Rolle des Staates Innovationen oft nicht zum Fliegen kommen. So seien beispielsweise Investitionen von 465 Mio $, welche die Obama-Administration in Tesla getätigt hatte, entscheidend dafür verantwortlich, dass Tesla bis heute überlebt und im Sommer 2020 bezüglich Börsenkapitalisierung den weltweit grössten Autohersteller Toyota überholt hat. Worauf er als Investor achtet, bevor er in eine Business-Idee investiert, lässt sich in fünf Punkten zusammenfassen:
- Is It a Big Idea?
- Clear Business Model/High Gross Margins?
- Strong team: Has the CEO had a Major Exit?
- Strong Sales Team?
- Is There Revenue Growth?
Wichtig sei, sich immer wieder neu zu erfinden, oder um es in Steve Jobs Worten zu sagen: «If you don’t cannibalize yourself, someone else will.»
Die Rolle des Staates in der Innovation
Im letzten Vortrag ging Prof. Tobias Schmidt (ETH Zürich) der Frage nach, inwiefern staatliches Handeln für Innovationen förderlich oder hinderlich ist. Er plädierte dafür, dass es ein Miteinander von Staat und Unternehmertum geben müsse. Mit Sicherheit würden Rahmenbedingungen, wie die Internalisierung der externen Kosten sowie umweltgerechte Preise, eine wichtige Rolle dabei spielen, welche Technologien am Markt erfolgreich sind. Solche externen Preise festzulegen, könne nur Aufgabe des Staates sein. Zudem könne nachgewiesen werden, dass nicht nur Elektrofahrzeuge und Photovoltaikmodule, sondern auch zahlreiche andere Innovationen ohne eine Frühförderung des Staates kaum zu marktfähigen Produkten hätten werden können. Weil der Staat nicht dagegen gefeilt ist, auf falsche Technologien zu setzen, ist es wichtig, auf einen Portfolioansatz zu setzen und so innerhalb eines wichtigen Innovationsfeldes die technische Evolution zu ermöglichen. Im Übrigen sei es auch nicht bewiesen, dass der Markt in Bezug auf die Selektion von erfolgreichen Technologien so erfolgreich sei.
Politische Rahmenbedingungen
Hier setzt auch Nationalrätin Barbara Schaffner (GLP) an, die u.a. gemeinsam mit Susanne Vincenz-Stauffacher (FDP) die parlamentarische Gruppe Cleantech präsidiert. Die Gruppe arbeitet eng mit swisscleantech zusammen und soll Unternehmen den direkten Zugang ins Parlament ermöglichen. Im Gespräch mit Christian Zeyer zeigt sie auf, welche Möglichkeiten zur Innovationsforderung in der Schweiz bestehen: Neben dem Technologiefonds, der Umwelttechnologieförderung und den Angeboten von Innosuisse gibt es neu auch Innobooster (z.B. energy Lab (HSLU), Applied Circular Sustainability Lab (ZHAW)). Diese Organisationen sollen helfen, Lücken zwischen firmeninterner Forschung und Grundlagenforschung zu schliessen. Oftmals bestünde die Herausforderungen darin, Innovationen im Markt zu etablieren. Dazu brauche es Venture Capital. Hier besteht in der Schweiz noch grosses Potenzial – dies bestätigten auch die Teilnehmenden des virtuellen Jahresanlasses.
- Dominique Kronenberg «Von der Idee zum Markterfolg: Die Geschichte von Climeworks» ab 00:11:55
- Lone Feifer «Die bereinigte CO2-Buchhaltung» ab 00:36:05
- Steve Westly «Picking the Right: What makes impact investment successful» ab 00:56:39
- Prof. Dr. Tobias Schmidt «Die Rolle des Staates in der Innovation» ab 1:20:35
- Gespräch Barbara Schaffner & Christian Zeyer ab 1:39:37
Präsentationen
Climeworks D. Kronenberg: Von der Idee zum Markterfolg: Die Geschichte von Climeworks
Velux L. Feifer: Die bereinigte CO2-Buchhaltung
The Westly Group St. Westly: Picking the Right: What makes impact investment successful
ETH T. Schmidt Die Rolle des Staates in der Innovation