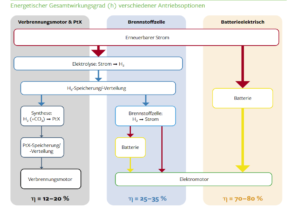Im Moment dominiert die Coronakrise unser Leben. Die Bedrohung durch den Klimawandel wird aber nicht geringer. Will die Schweiz bis spätestens 2050 klimaneutral werden, muss die Energieversorgung grundlegend transformiert werden. Wie kann das gelingen? Welche sozialen, ökonomischen und regulatorischen Aspekte sind relevant? Und wie lassen sich private und öffentliche Akteure einspannen, damit Energie effizient genutzt wird?
Auf diese Fragen möchten wir Ihnen in dieser aussergewöhnlichen Zeit Antworten liefern. Wir starten deshalb eine Webinar-Serie: Jeweils am Donnerstag von 16.30 bis 18.00 Uhr stellen Wissenschaftler*innen ihre Forschung vor und diskutieren mit uns aktuelle Fragen.
Basis dieser Webinar-Serie bildet das Nationale Forschungsprogramme NFP «Energie» des Schweizerischen Nationalfonds. Wir sind stolz, dass wir diese führenden Forscher*innen der Schweiz dafür gewinnen konnten. Sie haben vor kurzem ihre Projekte abgeschlossen und haben dabei eine Vielzahl neuer Erkenntnisse erarbeitet, zur Förderung von erneuerbarer Energien und Lenkungsabgaben ebenso wie dazu, wie Haushalte ihren Energieverbrauch senken oder wie sich neue Mobilitätformen durchsetzen. Bis heute hat dieses Wissen kaum den Weg in die Öffentlichkeit gefunden. Umso mehr freuen wir uns, dass die NFP-Forscher*innen ihr Wissen mit uns teilen.
Eine wichtige Erkenntnisse schon vorweg: Mit den heute bekannten technischen und finanziellen Mitteln ist der Ausstieg aus der Kernenergie und der fossilen Energiewelt möglich, und zwar auf wirtschaftliche und sozial verträgliche Art. Allerdings erfolgt dieser Wandel nicht von alleine, sondern alle müssen ihren Beitrag leisten. Genau dieses Grundverständnis trägt die Arbeit von swisscleantech, um die Wirtschaft klimatauglich zu machen.
Das erste Webinar zur Schweizer Energiezukunft findet am Donnerstag 30.4. um 16.30 Uhr statt und widmet sich der grundlegenden Frage nach Wahrnehmung und Umsetzung. Ihnen werden Forschungsresultate zur Akzeptanz erneuerbarer Energie, zum Umgang mit der Landschaft sowie zu Bedingungen eines gesellschaftlichen Konsens vermittelt. Hier finden Sie die näheren Informationen dazu.
Weitere geplante Webinare der Serie finden Sie in unserer Web-Agenda.
Mehr Informationen zu allen Projekten finden Sie unter: www.nfp-energie.ch