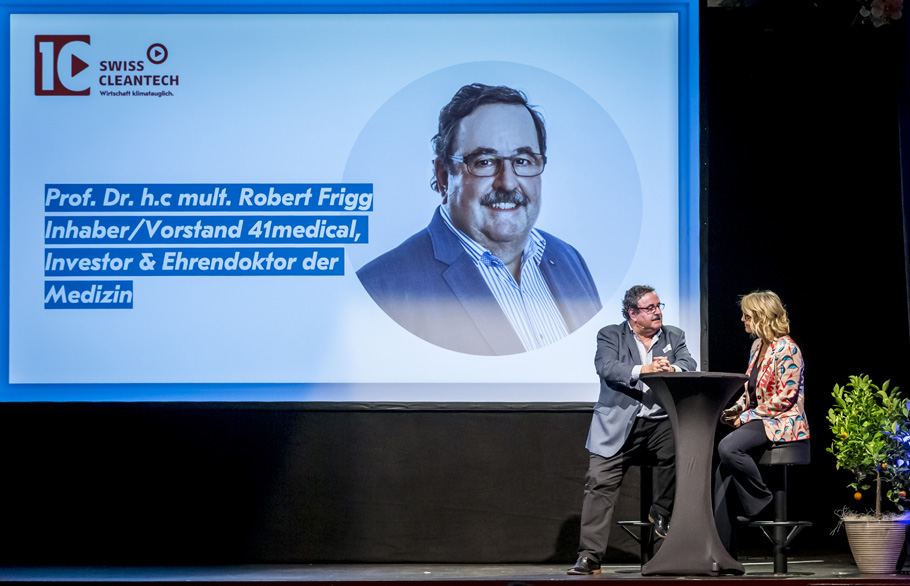Die Umweltkommission des Nationalrats nimmt die Beratungen der Vorlage Ende Oktober auf. Nachfolgend findet sich eine Einordnung zu den einzelnen Bereichen :
(Stand nach Beratungen durch den Ständerat Herbst 2019)
Ungenügendes Inlandziel
Der Ständerat hat ein Inlandziel von minus 30% bis 2030 verabschiedet (60% der Halbierung der Treibhausgasemissionen der Schweiz bis 2030). Das ist ungenügend. Um die Ziele des Pariser Klimaabkommens einzuhalten, braucht es ein deutlich höheres Inlandziel. Der Bundesrat hat ein Netto-null-Klimaziel bis 2050 festgelegt. Damit dies erreicht wird, muss im CO2-Gesetz ein Inlandziel von mindestens minus 45% bis 2030 verankert werden. Dies ist aus wissenschaftlicher Sicht notwendig und stärkt den Werkplatz Schweiz: Es schafft Innovationsanreize und Planungssicherheit für die Unternehmen. Wie eine Studie von econcept zeigt, ist eine Inlandreduktion von bis zu 48% bis 2030 im Inland machbar und wirtschaftlich vorteilhaft.
Frühzeitige CO2-Grenzwerte für Gebäude sind wichtig und richtig Gebäude sind für 26% der CO2-Emissionen der Schweiz verantwortlich. Die Sanierungsrate ist zu tief, grosse Effizienzpotenziale liegen brach. Um die Emissionen im Gebäudebereich ohne Verzug zu reduzieren, ist ein verbindlicher, frühzeitig eingeführter Emissionsgrenzwert pro m2 Energiebezugsfläche, der kontinuierlich abgesenkt wird, wichtig. Der Entscheid des Ständerats, einen solchen Standard ab 2023 einzuführen, ist demnach richtig: Neben der Stärkung der CO2-Abgabe (der Abgabesatz soll, wenn Zwischenziele nicht erreicht werden, sukzessive auf max. CHF 210 erhöht werden) und des Gebäudeprogramms, trägt die Einführung dieses Grenzwerts als dritte Säule dazu bei, dass auch der Gebäudesektor den notwendigen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele leisten kann. Dies reduziert auch das Risiko, Gelder in einen nicht energieeffizienten Gebäudepark zu investieren und später mit hohen Folgekosten konfrontiert zu werden.
Wirksame Massnahmen im Verkehr sind essentiell
Der Strassenverkehr ist nach wie vor die grösste CO2-Emissionsquelle in der Schweiz. Seit 1990 sind diese sogar gestiegen. Es ist erfreulich, dass der Ständerat mit den Flottenzielen der Schweiz nicht hinter die EU-Regelungen zurückfällt und auch den Schwerverkehr einbeziehen möchte. Mit der Kompensationspflicht für Importeure fossiler Treibstoffe – wobei der Ständerat den Treibstoffaufschlag bei 10-12 Rappen pro Liter Treibstoff deckeln möchte – tragen Treibstoffimporteure nicht direkt zur Dekarbonisierung des Verkehrssektors bei. Dafür können sie aber den Klimaschutz im Inland unterstützen. Es macht deshalb Sinn, den im Inland zu kompensierenden Anteil, wie es der Ständerat entschieden hat, auf 20% zu erhöhen. swisscleantech begrüsst auch, dass ein kleiner Teil der über den Treibstoffpreis finanzierten Klimaschutzmassnahmen für die Förderung der Elektromobilität reserviert werden soll. Damit wird sichergestellt, dass auch Kompensationsprojekte im Verkehrsbereich durchgeführt und die Wertschöpfung in der Schweiz gestärkt wird.
Nachhaltige Mobilität verlangt aber mehr als effiziente Fahrzeuge. Es ist deshalb zu begrüssen, dass der Ständerat zusätzlich ein Postulat verabschiedet hat, um konkrete Vorschläge für eine CO2-Lenkungsabgabe auf Treibstoffe und die Einführung eines Mobility Pricings zu prüfen. Im Verkehrswesen muss dringend Kostentransparenz hergestellt werden. Diese Lösungsansätze müssen schnell vorangetrieben werden, denn sie sind essentiell für einen klimafreundlichen, kostendeckenden und effizient organisierte Verkehr.
Einführung einer Flugticketabgabe ist begrüssenswert
Der Ständerat hat sich für die Einführung einer Flugticketabgabe ausgesprochen. swisscleantech befürwortet das. Der Flugverkehr wächst rasant, ist steuerbefreit und bisher zeigen internationale Massnahmen keine Wirkung. Eine Flugticketabgabe pro Flugticket von mind. 30 und max. 120 CHF, gemäss Ständerat, bringt den Flugverkehr noch nicht auf einen Paris-kompatiblen Weg, sendet aber ein wichtiges Signal: KonsumentInnen könnten motiviert werden, auf klimafreundlichere Verkehrsalternativen umzusteigen.
Neuer Klimafonds stärkt Innovationsanreize
Der Ständerat hat entschieden, einen umfassenden Klimafonds für Massnahmen in folgenden Bereichen zu schaffen: Gebäudemodernisierung, Energieeffizienz, beschleunigte Umstellung auf eine CO2-freie Wärmeproduktion, Unterstützung von Projekten zur nachhaltigen Verminderung von Treibhausgasemissionen und der Verminderung von Klimaschäden. Der Fonds soll aus Teilen der CO2-Abgabe, der Flugticketabgabe sowie dem Ertrag aus den Versteigerungen von Emissionsrechten gespiesen werden. In den Klimafonds integriert werden auch der Technologiefond sowie das Gebäudeprogramm, welches punktuell gestärkt werden soll. Ein solcher Fonds ist grundsätzlich begrüssenswert und bietet Innovationsanreize für die Entwicklung von klimafreundlichen Lösungsansätzen. Bei der Speisung des Fonds ist allerdings darauf zu achten, dass Zweckbindungen effizient und wirksam ausgestaltet werden und dies regelmässig überprüft wird.
Klimaverträglicher Finanzsektor ist zentral und kann im CO2-Gesetz gestärkt werden
Zu begrüssen ist, dass der Ständerat die Bedeutung der Finanzflüsse für die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens anerkennt und dies im Zweckartikel festhält. Neu sollen die Schweizerische Nationalbank (SNB) und die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) regelmässig ihre klimabedingten finanziellen Risiken prüfen und dem Bundesrat Bericht erstatten. Weitere konkrete Massnahmen hat der Ständerat allerdings nicht in die Vorlage aufgenommen. Vielmehr hat er den Bundesrat in Postulaten dazu aufgefordert, weitergehende Instrumente zu prüfen. Dies ist eine verpasste Chance, denn durch den Schweizer Finanzsektor werden rund zwanzigmal mehr CO2-Emissionen verursacht als im Inland selbst, womit der Finanzsektor ein grosser Hebel für den Klimaschutz ist. In der EU ist zurzeit eine tiefgreifende Reform zur Nachhaltigkeit der Finanzindustrie im Gange. Auch die Schweiz ist hier gefordert. Aus Sicht von swisscleantech ist es deshalb wichtig, dass im Rahmen der CO2-Gesetzesrevision konkrete Massnahmen ausgearbeitet werden – insbesondere was die Transparenz von Klimarisiken und -auswirkungen von Finanzmitteln betrifft.
Weiterführende Informationen zur Totalrevision des CO2 Gesetzes
Für Rückfragen: martina.novak(at)swisscleantech.ch