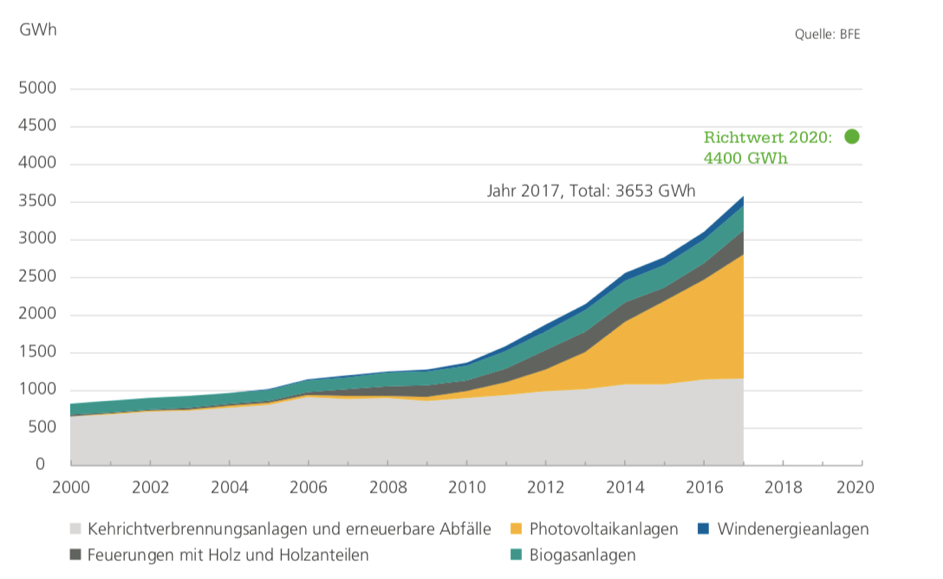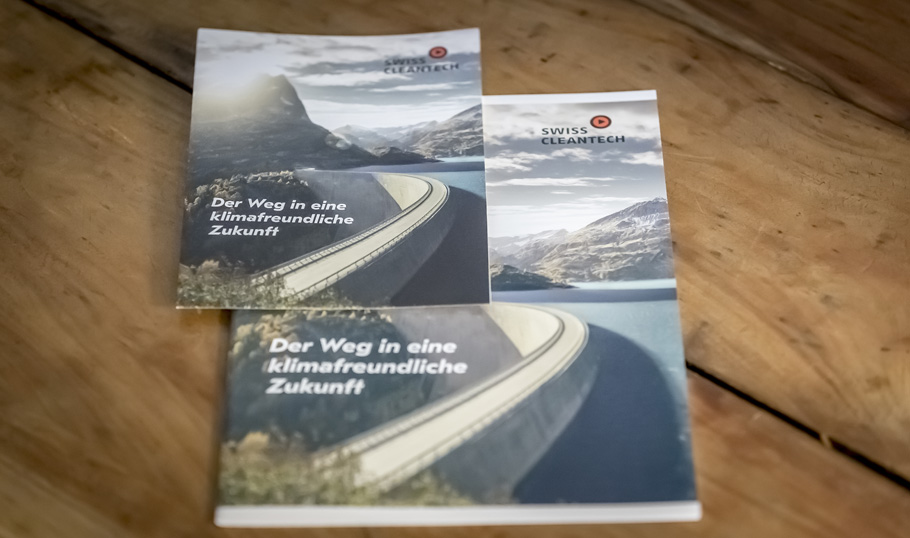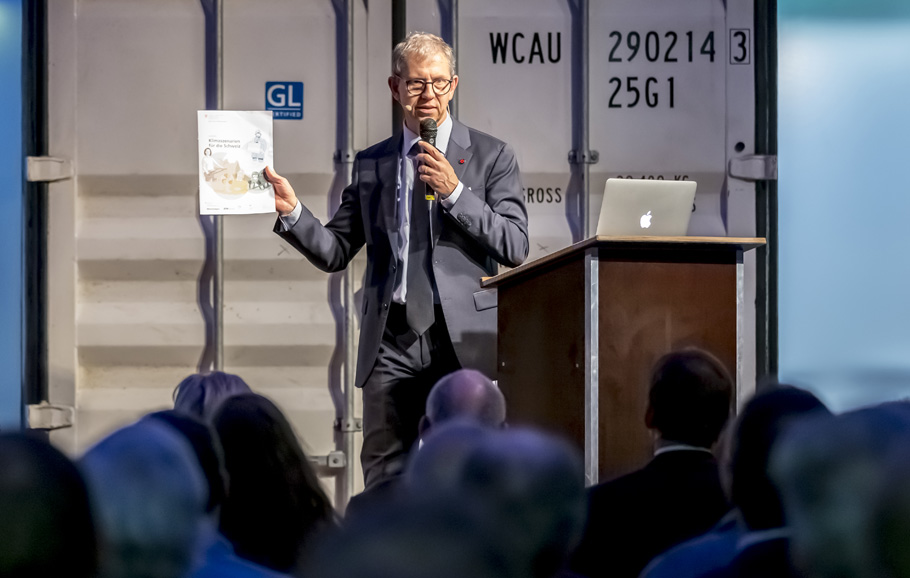Der Klimawandel ist in vollem Gange und trifft auch die Schweiz. Klimaschutz ist daher umso wichtiger und schafft Chancen für Firmen. «Wir sind an einem Ort des Aufbruchs angekommen. Es ist Zeit für eine positive Vision», sagte Christian Zeyer, Geschäftsführer des Wirtschaftsverbandes swisscleantech, an einer Veranstaltung am Dienstag im Kraftwerk in Zürich. swisscleantech-Präsident Matthias Bölke, Vice President Strategy, Business Excellence & Public Affairs Schneider Electric in den deutschsprachigen Ländern, fügte per Videobotschaft aus Berlin hinzu: «Klimaschutz ist global, aber der Beitrag dazu ist lokal.»
Wie das geht, zeigte zum Beispiel Paul Schär auf. Schär hat 2001 die 1848 Hector Egger Holzbau in Langenthal BE übernommen und auf inzwischen 120 Mitarbeitende ausgebaut. Bauen mit Holz ist für ihn ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz: Das verbaute Holz speichert CO2 dauerhaft. Schär sieht dafür in der Schweiz noch ein grosses Potential. Der Anteil des Holzes am Bauvolumen sei mit bis zu 16 Prozent nur halb so hoch wie in Österreich. In Norwegen betrage der Holzanteil sogar 80 Prozent. Dabei könnte in der Schweiz bis zu 30 Meter hoch nach den gleichen regulatorischen Vorgaben gebaut werden wie mit Beton. Schär geht in seinen eigenen Werken noch weiter: Seine Gebäude erzeugen 30 Prozent mehr Strom, als sie brauchten, die Holzschnitzel würden für Fernwärme genutzt. Sein nächstes Projekt sei es, den eigenen Strom auch zu speichern.
Martin Kyburz setzt bei der Mobilität an. Der Gründer von Kyburz Switzerland in Freienstein ZH mit mehr als hundert Beschäftigten stellt Elektrofahrzeuge her. Seit Jahren fahren die Postboten der Schweizerischen Post auf seinen Dreirädern, die alten Schweizer Dreiräder werden für die ungarische Post aufgefrischt und mit einer Garantie versehen, selbst in Australien kann Kyburz nun einen Servicebetrieb für seine Exporte aufbauen. Insgesamt hat er bereits mehr als 16.000 Fahrzeuge verkauft. Kyburz hat im vergangenen Jahr einen Umsatz von 26 Millionen Franken erzielt, rechnet mit 34 Millionen in diesem Jahr und erwartet 45 Millionen im nächsten. Seine Fahrzeuge seien umweltfreundlich, sicher und kosteneffizient, sagt Kyburz.
Reto Ringger geht davon aus, dass die derzeitige Disruption, der tiefgreifende Wandel in vielen Branchen, verstärkt zugunsten des Umweltschutzes eingesetzt werden muss. «Es braucht eine positive Disruption, die die Grenzen des Planeten berücksichtigt», sagte der Gründer der Globalance Bank in Zürich. Allerdings liege gerade seine Branche dabei weit zurück. Die meisten Finanzunternehmen seien wenig transparent, welche Wirkung die von ihnen verwalteten Gelder erzielten.
-

-
swisscleantech Winteranlass am 13. November 2018 in Zuerich fotografiert von Thomas Hodel
-

-
swisscleantech Winteranlass am 13. November 2018 in Zuerich fotografiert von Thomas Hodel
-
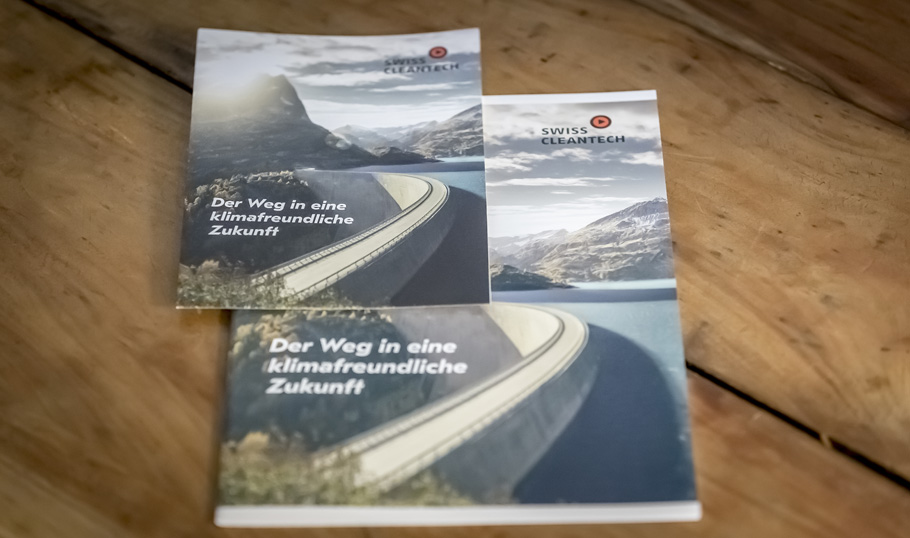
-
swisscleantech Winteranlass am 13. November 2018 in Zuerich fotografiert von Thomas Hodel
-

-
swisscleantech Winteranlass am 13. November 2018 in Zuerich fotografiert von Thomas Hodel
-

-
swisscleantech Winteranlass am 13. November 2018 in Zuerich fotografiert von Thomas Hodel
-

-
swisscleantech Winteranlass am 13. November 2018 in Zuerich fotografiert von Thomas Hodel
-

-
swisscleantech Winteranlass am 13. November 2018 in Zuerich fotografiert von Thomas Hodel
-

-
swisscleantech Winteranlass am 13. November 2018 in Zuerich fotografiert von Thomas Hodel
-

-
swisscleantech Winteranlass am 13. November 2018 in Zuerich fotografiert von Thomas Hodel
-

-

-
swisscleantech Winteranlass am 13. November 2018 in Zuerich fotografiert von Thomas Hodel
-

-
swisscleantech Winteranlass am 13. November 2018 in Zuerich fotografiert von Thomas Hodel
-

-
swisscleantech Winteranlass am 13. November 2018 in Zuerich fotografiert von Thomas Hodel
-

-
swisscleantech Winteranlass am 13. November 2018 in Zuerich fotografiert von Thomas Hodel
-

-
swisscleantech Winteranlass am 13. November 2018 in Zuerich fotografiert von Thomas Hodel
-

-
swisscleantech Winteranlass am 13. November 2018 in Zuerich fotografiert von Thomas Hodel
-

-
swisscleantech Winteranlass am 13. November 2018 in Zuerich fotografiert von Thomas Hodel
-

-
swisscleantech Winteranlass am 13. November 2018 in Zuerich fotografiert von Thomas Hodel
-

-
swisscleantech Winteranlass am 13. November 2018 in Zuerich fotografiert von Thomas Hodel
-

-
swisscleantech Winteranlass am 13. November 2018 in Zuerich fotografiert von Thomas Hodel
-

-
swisscleantech Winteranlass am 13. November 2018 in Zuerich fotografiert von Thomas Hodel
-

-
swisscleantech Winteranlass am 13. November 2018 in Zuerich fotografiert von Thomas Hodel
-

-
swisscleantech Winteranlass am 13. November 2018 in Zuerich fotografiert von Thomas Hodel
-

-
swisscleantech Winteranlass am 13. November 2018 in Zuerich fotografiert von Thomas Hodel
-

-
swisscleantech Winteranlass am 13. November 2018 in Zuerich fotografiert von Thomas Hodel
-

-
swisscleantech Winteranlass am 13. November 2018 in Zuerich fotografiert von Thomas Hodel
-

-
swisscleantech Winteranlass am 13. November 2018 in Zuerich fotografiert von Thomas Hodel
-

-
swisscleantech Winteranlass am 13. November 2018 in Zuerich fotografiert von Thomas Hodel
-

-
swisscleantech Winteranlass am 13. November 2018 in Zuerich fotografiert von Thomas Hodel
-

-
swisscleantech Winteranlass am 13. November 2018 in Zuerich fotografiert von Thomas Hodel
-

-
swisscleantech Winteranlass am 13. November 2018 in Zuerich fotografiert von Thomas Hodel
-

-

-
swisscleantech Winteranlass am 13. November 2018 in Zuerich fotografiert von Thomas Hodel
-

-
swisscleantech Winteranlass am 13. November 2018 in Zuerich fotografiert von Thomas Hodel
-

-
swisscleantech Winteranlass am 13. November 2018 in Zuerich fotografiert von Thomas Hodel
-

-
swisscleantech Winteranlass am 13. November 2018 in Zuerich fotografiert von Thomas Hodel
-

-
swisscleantech Winteranlass am 13. November 2018 in Zuerich fotografiert von Thomas Hodel
-

-
swisscleantech Winteranlass am 13. November 2018 in Zuerich fotografiert von Thomas Hodel
-

-
swisscleantech Winteranlass am 13. November 2018 in Zuerich fotografiert von Thomas Hodel
-

-
swisscleantech Winteranlass am 13. November 2018 in Zuerich fotografiert von Thomas Hodel
-

-
swisscleantech Winteranlass am 13. November 2018 in Zuerich fotografiert von Thomas Hodel
-

-
swisscleantech Winteranlass am 13. November 2018 in Zuerich fotografiert von Thomas Hodel
-

-
swisscleantech Winteranlass am 13. November 2018 in Zuerich fotografiert von Thomas Hodel
-

-
swisscleantech Winteranlass am 13. November 2018 in Zuerich fotografiert von Thomas Hodel
-

-
swisscleantech Winteranlass am 13. November 2018 in Zuerich fotografiert von Thomas Hodel
-
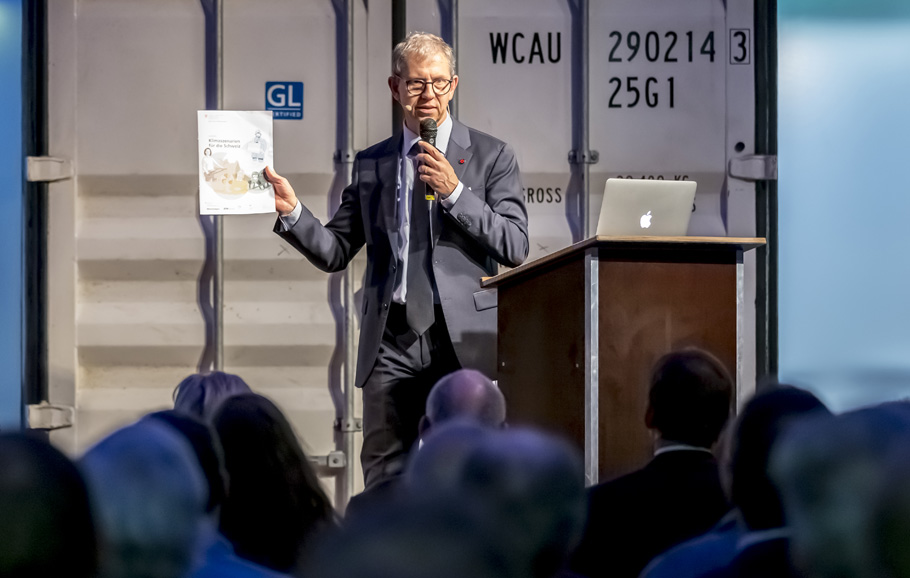
-
swisscleantech Winteranlass am 13. November 2018 in Zuerich fotografiert von Thomas Hodel
-

-
swisscleantech Winteranlass am 13. November 2018 in Zuerich fotografiert von Thomas Hodel
-

-
swisscleantech Winteranlass am 13. November 2018 in Zuerich fotografiert von Thomas Hodel
-

-
swisscleantech Winteranlass am 13. November 2018 in Zuerich fotografiert von Thomas Hodel
-

-
swisscleantech Winteranlass am 13. November 2018 in Zuerich fotografiert von Thomas Hodel
-

-
swisscleantech Winteranlass am 13. November 2018 in Zuerich fotografiert von Thomas Hodel
-

-
swisscleantech Winteranlass am 13. November 2018 in Zuerich fotografiert von Thomas Hodel
-

-
swisscleantech Winteranlass am 13. November 2018 in Zuerich fotografiert von Thomas Hodel
-

-
swisscleantech Winteranlass am 13. November 2018 in Zuerich fotografiert von Thomas Hodel
-

-
swisscleantech Winteranlass am 13. November 2018 in Zuerich fotografiert von Thomas Hodel
-

-
swisscleantech Winteranlass am 13. November 2018 in Zuerich fotografiert von Thomas Hodel
-

-
swisscleantech Winteranlass am 13. November 2018 in Zuerich fotografiert von Thomas Hodel
-

-
swisscleantech Winteranlass am 13. November 2018 in Zuerich fotografiert von Thomas Hodel
-

-
swisscleantech Winteranlass am 13. November 2018 in Zuerich fotografiert von Thomas Hodel
-

-
swisscleantech Winteranlass am 13. November 2018 in Zuerich fotografiert von Thomas Hodel
-

-
swisscleantech Winteranlass am 13. November 2018 in Zuerich fotografiert von Thomas Hodel
-

-
swisscleantech Winteranlass am 13. November 2018 in Zuerich fotografiert von Thomas Hodel
Podiumsdiskussion über Innovationspotenzial der Schweiz
Jürg Grossen, selber Unternehmer, Nationalrat und Präsident der Grünliberalen, sieht gerade auch die Politik gefordert. «Es braucht klare Anreize und Bepreisungen.» Das CO2-Gesetz, das nun in den Nationalrat komme, sei dabei viel zu wenig ambitioniert. «Dabei hätte die Schweiz als Innovationsland hier grosses Potenzial gehabt.»
Sein liberaler Basler Nationalratskollege Christoph Eymann vermutet, dass der Bundesrat ganz pragmatisch eine Niederlage in einer Referendumsabstimmung vermeiden wolle. Es brauche aber «andere Allianzen» im Klimaschutz. «swisscleantech ist eine solche Organisation, denn sie paart Unternehmertum und ökologisches Bewusstsein», so Eymann.
Der Bundesrat schlägt im neuen CO2-Gesetz vor, dass der CO2-Ausstoss der Schweiz bis 2030 um 50 Prozent im Vergleich zu 1990 verringert wird, davon zu 30 Prozent im Inland. swisscleantech will hingegen 40 Prozent im Inland verringern.
Dokumente zum Download
«Klimaeffizienz dank Holzbau»
Präsentation von Paul Schär, CEO Hector Egger Holzbau
«Erfolg auf drei Rädern»
Martin Kyburz, CEO Kyburz Switzerland AG
«Disruption in der Wirtschaft: Chance für unseren Planeten?»
Reto Ringger, Gründer & CEO Globalance Bank