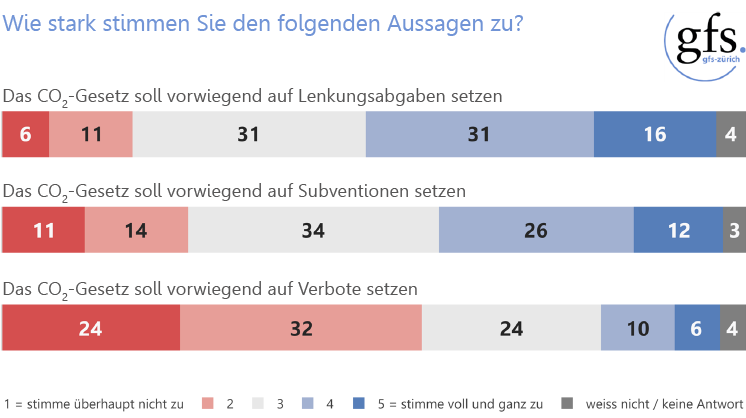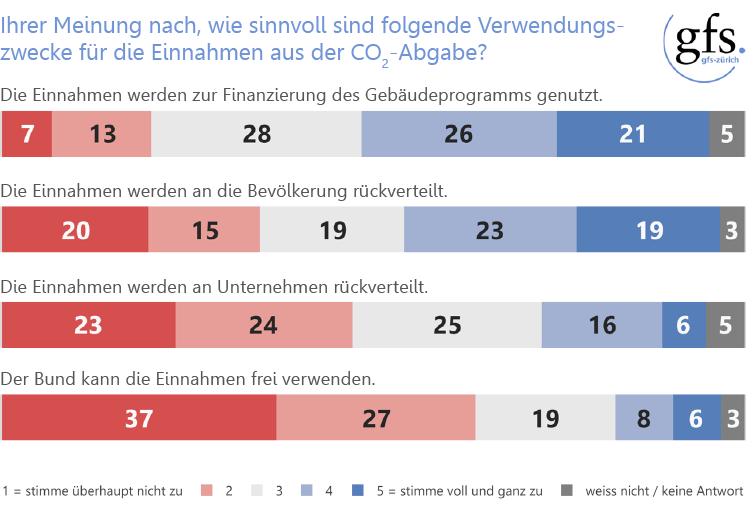Der Krieg in der Ukraine hat viel Bewegung in die Energiepolitik gebracht. Das zeigte sich zuletzt bei den dringlichen Beschlüssen des Parlaments zugunsten eines beschleunigten Ausbaus der Solar- und Windenergie. Diese Dynamik war in den letzten Tagen auch im Nationalrat spürbar. Co-Geschäftsführer Michael Mandl sagt dazu: «Dank der speditiven Arbeit des Nationalrates können wir hoffentlich noch vor dem Ende dieser Legislatur einen wichtigen Schritt zur Sicherung unserer Stromversorgung mit erneuerbaren Energien machen. Wir ziehen eine positive Bilanz und sind sehr erfreut, dass wir uns in den Beratungen erfolgreich für diverse Anliegen unserer Mitglieder einsetzen konnten – dazu gehört mitunter mehr Innovation im Verteilnetz.» Es besteht aber weiterhin Korrekturbedarf. Darum wird sich swisscleantech auch in der weiteren Beratung im Ständerat einbringen.
Ausbau von erneuerbaren Energien
Die erneuerbaren Energien müssen massiv ausgebaut werden – aber nicht auf Kosten der Biodiversität. Hier ging der Ständerat in seiner Erstberatung zu weit, was nun vom Nationalrat korrigiert wurde. Der gefundene Kompromiss zwischen Schutz der Biodiversität und der Energieerzeugung festigt den Biotopschutz, ermöglicht aber gleichzeitig den Bau von Wasserkraftanlagen in Gletschervorfeldern. Bedauerlich war hingegen der Beschluss zur Sistierung des Gewässerschutzes bei Erneuerungen und Erweiterungen von Wasserkraftwerken. Der dadurch mögliche Produktionsgewinn in den kritischen Wintermonaten steht in keinem Verhältnis zur Einschränkung des Gewässerschutzes. Darum ist für swisscleantech klar, dass der Ständerat hier korrigierend eingreifen muss.
Trotzdem ist swisscleantech erfreut, dass der Nationalrat wichtige Beschlüsse zugunsten der Erhöhung von Ausbauzielen sowie den konkreten Fördermassnahmen für erneuerbare Energien gefällt hat. Nur so kommen wir der Dekarbonisierung der Schweiz näher.
Förderung der Energieeffizienz
In vielen Fällen ist die eingesparte Energie nach wie vor die günstigste Energie. Mit dem Beschluss des Nationalrates zugunsten von Zielvorgaben für Elektrizitätslieferanten wird ein sinnvolles Instrument eingeführt, um einen Dienstleistungsmarkt für Effizienzmassnahmen zu schaffen. Besonders wichtig: Mit der Lösung des Nationalrates wird die notwendige Elektrifizierung von Verkehr und Wärmeversorgung nicht gefährdet, weil der Energieverbrauch nicht reduziert werden muss.
Innovation im Verteilnetz
Das Stromsystem der Zukunft ist erneuerbar, dezentral und digital. Damit der Umbau möglichst rasch und kostengünstig vorangeht, brauchen wir mehr Innovation. Der grösste Innovationstreiber wäre eine vollständige Marktöffnung. Da diese in der gegenwärtigen Lage stark umstritten ist, verstehen wir, dass sich der Nationalrat dagegen entschieden hat.
Damit unser Stromsystem trotzdem zukunftsweisend gestaltet werden kann, braucht es einen flexiblen Ausgleich von Produktion und Verbrauch auf lokaler Ebene, smarte Netze und einen gezielten Netzausbau. Dafür benötigt es passende regulatorische Rahmenbedingungen, die nun zumindest teilweise vom Nationalrat geschaffen wurden:
- Erfreulich ist der Beschluss zugunsten des diskriminierungsfreien und fairen Zugangs zu den Messdaten. Dies ist eine Grundvoraussetzung für innovative Geschäftsmodelle und für grössere Transparenz im Stromnetz und ein grosser Erfolg zugunsten jener Mitglieder von swisscleantech, die sich beispielsweise für flexible Ladelösungen oder netzdienliche Speicher engagieren.
- swisscleantech begrüsst, dass der Nationalrat das Netzentgelt für dezentrale Stromspeicher wie stationäre Batteriespeicher und Fahrzeugbatterien neu regelt und damit deren netz- und systemdienliche Benutzung attraktiver macht.
- swisscleantech konnte sich erfolgreich dafür einsetzen, dass die Rahmenbedingungen für lokale Elektrizitätsgemeinschaften optimiert wurden. Damit wird der Ausgleich von Produktion und Verbrauch auf lokaler Ebene gefördert, was wiederum die Kosten für den Netzausbau senken kann.